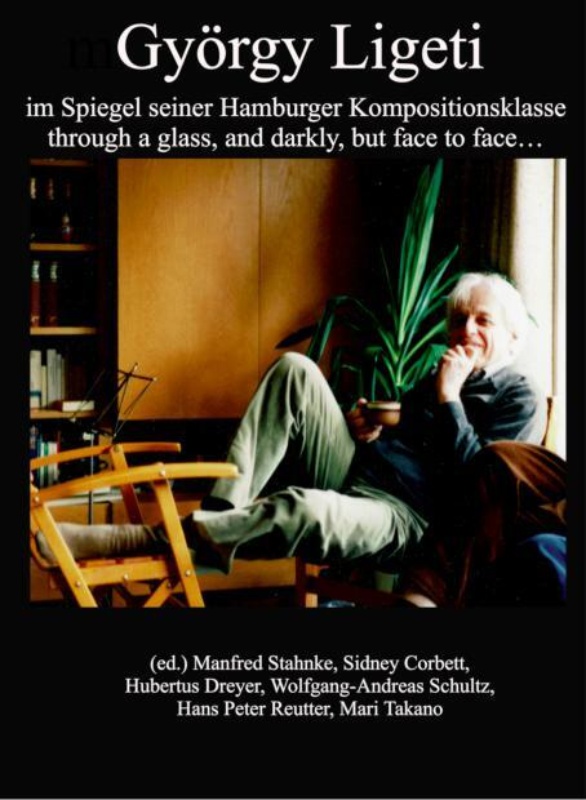Die Arbeit an seinem Requiem hat den Komponisten schier verschlungen: Von bis zu vierzehnstündigen Arbeitstagen schreibt György Ligeti im Winter 1964; er fühle sich inmitten liegenbleibender Alltagsaufgaben „wie ein Ertrinkender“. In dem Brief an den Musikredakteur Ove Nordwall in Stockholm, wo das etwa halbstündige Werk zur Uraufführung kommen sollte, wird der Stellenwert klar, den diese Arbeit für ihn hatte: Das Requiem und vor allem sein Dies irae sei das Beste, was er bisher komponiert habe. Sein Bezug auf Kunst des 15. und 16. Jahrhunderts (neben Hans Memling nennt er Pieter Breughel den Älteren, Hieronymus Bosch und Dürers Kupferstiche) passt dabei zu einem musikalischen Referenzpunkt des Werkes, der Polyphonie von Renaissance-Komponisten wie Johannes Ockeghem. György Ligeti räumt ein, dass das Werk aufgrund der streng polyphonen Satztechnik konservativ wirken und sein Publikum enttäuschen könnte. Doch dem stellt er entgegen: „Es kümmert mich nicht, ob ich zur ‚Avantgarde’ oder zur ‚Reaktion’ gerechnet werde. Es kümmert mich nur, diejenige Musik zu komponieren, die mir vorschwebt. Ideologische Gesichtspunkte sind für mich unwesentlich, und ich will meine Musik nicht ideologisch-theoretisch untermauern.“
Künstlerisches Ergebnis dieser (durchaus biografisch begründeten) ideologiekritischen Haltung ist keineswegs ein konservatives Werk, sondern eine sich bahnbrechend neben scheinbar duale Kategorien wie tonal und atonal, modern und traditionell stellende Komposition. Es lohnt sich, wie auch bei seinen anderen Werken, György Ligetis eigene einführende Worte zum Requiem zu lesen – sie (als vollwertiger Musik-Nerd) vielleicht sogar mit der Partitur in der Hand zu studieren. Die Genauigkeit seiner Erklärungen lädt dazu durchaus ein. Regelrecht hineinzoomen lässt sich in die Struktur des Requiems. Dann wird nachvollziehbar, wie eine 20stimmige Polyphonie, für die die Partitur einen rund hundertköpfigen Chor fordert, überhaupt zustande kommen und hörend verständlich sein kann.
Die Zoomebene bezeichnet György Ligeti als Mikropolyphonie: Jede einzelne der fünf Chor-Hauptstimmen ist in Unterstimmen geteilt, die so ineinander verschlungen sind, „dass ihre Bewegungen sich wechselseitig ergänzen und aufheben. Das so entstehende klangliche Irisieren beruht vor allem auf der gleichsam versteckten Polyphonie.“ Diese kontrapunktische Organisation des Klanges selbst (und nicht der melodischen Ebene) ist auch schon im Introitus, dem ersten der vier Sätze zu hören. Er hat einen statischen Charakter; innerhalb dieser Bewegungslosigkeit verändert sich der Klang jedoch durch verschiedene Farben von dunkel nach hell.
Die nächste polyphone Ebene – diejenige ohne Zoom sozusagen – kommt ab dem Kyrie ins Spiel. Der mikropolyphonen Klangfarben-Ebene der Unterstimmen wird eine kontrapunktische Großarchitektur zwischen den Hauptstimmen hinzugefügt. „Derart bilden die ‚Unterstimmen’ das mikropolyphone Substrat; ihre Vereinigung, als Hauptstimme, ergibt mit den anderen Hauptstimmen die große kontrapunktische Struktur. Der gesamte Satz, der unaufhörlich, wie ein scheinbar unermesslich riesiges Gebilde erwächst, wurde nach ganz bestimmten, strengen architektonischen Gesetzen entworfen. Diese Gesetze betreffen sämtliche musikalischen Beziehungen der Intervallik, Rhythmik und Dynamik, die Klangfarbendisposition, die polyphonen Verknüpfungen und den formalen Verlauf sowohl in Einzelheiten der Gliederung als auch im Ganzen der Großform“, so György Ligeti.
Den zentralen Satz des Werkes, das Dies irae, bezeichnete der Komponist als „exaltiert, hyperdramatisch und zügellos“. Eine „Polyphonie musikalischer Typen und Formen“ mit größten dramatischen Kontrasten entsteht mit abrupten Wechseln, Nah- und Fernwirkungen, dynamischen Extremen. Das abschließende Lacrimosa blicke hingegen auf das vorherige Geschehen zurück, wenn nur die beiden Solistinnen, Sopran und Mezzosopran, mit Begleitung eines reduzierten Orchesters singen. Durch und durch ein Vokalwerk ist das Requiem ohnehin, doch ist das kompakte Orchester für die gesamte Struktur des Werkes unerlässlich – als Rückgrat und als weitere Ebene der klangfarblichen und polyphonen Architektur.
„Sie werden sehen, dass diese vier Sätze des Requiems eine Art Zusammenfassung meiner bisherigen Kompositionsweise sind“, schreibt György Ligeti in seinem Brief vom Dezember 1964. „Kommende Kompositionen sind darin keimhaft enthalten. Deshalb betrachte ich das Requiem als eine Art Scheidelinie zwischen den bisherigen und den zukünftigen Stücken.“
Text: Nina Rohlfs, 1/2023
Kommende Aufführungen des Requiems:
16., 17. und 18.2.2023, Berliner Philharmonie
Berliner Philharmoniker, Sir Simon Rattle
Makeda Monnet, Sopran; Donatienne Michel-Dansac, Mezzosopran
Rundfunkchor Berlin